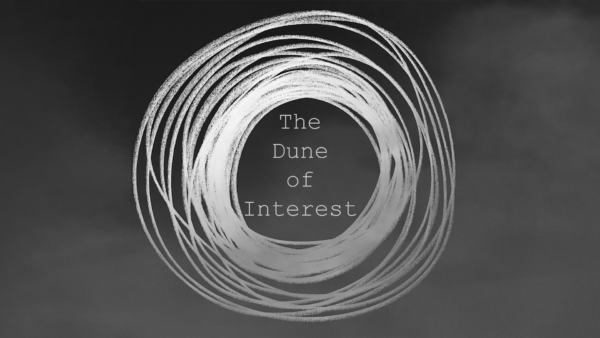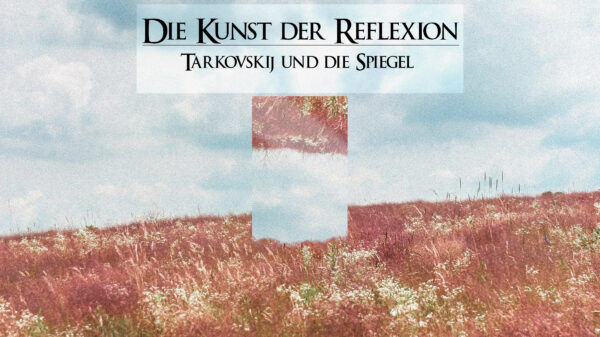Der japanische Großmeister der Science-Fiction Yasutaka Tsutsui (康隆 筒井) hat 1993 mit seinem Roman “Paprika” (パプリカ) ein Gedankenexperiment rund um die Psychoanalyse des Traums artikuliert, welches 2006 durch den Ausnahmeregisseur Satoshi Kon (敏 今) eine gebührende Verfilmung erhalten hat. Das Gedankenexperiment verfolgt die Idee, mithilfe eines neuronalen Devices an den Träumen anderer Personen luzid teilzuhaben. Christopher Nolans Film “Inception”, der sich mitunter an Roman und Anime als Vorlage orientiert, wird hier noch die populärste Adaption dieses Gedankenexperiments sein. Bei “Paprika” ist es das sogenannte DC Mini, welches die transzendente Partizipation an der Traumwelt ermöglicht, und ist im Werk Gegenstand avantgardistischer Entwicklungen in der Psychotherapie und erlaubt es zudem den Traum in audiovisueller Form über einen Computer zu betrachten und zu speichern. Obgleich die Traumdeutung konsensuell ad acta der Psychoanalyse gelegt wurde, schreit diese Prämisse nach Freud und verleiht der klassischen Traumdeutung durch die Partizipation am Traum gekonnt ein neues Spielfeld der psychoanalytischen Blickwinkel. “Paprika” zeigt spürbar eine Färbung psychoanalytischer Diskurse, und reicht sogar darüber hinaus, indem es sich diskursiv mit der zeitgenössisch anlaufenden Technologisierung der modernen Gesellschaften auseinandersetzt. Durch die gezeichnete Liminalität zwischen Traum und Realität vollführt das Werk damit gleichsam eine simulationstheoretische Auseinandersetzung, die klassisch an Baudrillard erinnert. Ich nehme im Folgenden den Film “Paprika” von Satoshi Kon als Ausgangsmaterial einer poststrukturalistischen Betrachtung, um die psychoanalytischen Ansätze und Muster des Werks vor Lacan’schem Hintergrund zu eruieren und eine Einordnung der Kritik an digitaler Transformation im gesellschaftlichen und psychoanalytischen Kontext vorzunehmen.
“Paprika” von Yasutaka Tsutsui ist in englischer Übersetzung erschienen bei Penguin Random House. Die Verfilmung durch Satoshi Kon wurde in Deutschland verlegt durch die Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH.
1. Traum, Trauma, Eskapismus
Für die Lacan’sche Psychoanalyse ist der Traum ein Objekt, welches um das Reale1, um das für das Subjekt ungreifbare, kreist und sich auf dessen unmittelbare Realität auswirkt. Traumata, die gemeinhin vom in einer Subjektspaltung in bewusst und unbewusst verdrängt werden, können so etwa als Teil des Realen angesehen werden, wobei das traumatische Moment sich in neurotischen und wiederholenden Mustern artikuliert. Der Traum kann sich dem Trauma, und damit dem Realen, heruntergebrochen in zweierlei Weise gegenüber verhalten. So kann der Traum zum einen als ein Phantasieren in Erscheinung treten, welches einer Konfrontation mit dem Realen vorbeugt. Konträr dazu kann der Traum aber ebenso eine Konfrontation mit dem Trauma darstellen. An dem Punkt invertiert also der zuerst genannte Zweck des Traums, wodurch das Aufwachen und die Rückkehr in die Realität viel eher die Konfrontation mit dem Realen auflöst. Als zwei exemplarische Figuren lernen wir im Verlauf des Filmes einmal den Patienten und Polizeibeamten Toshimi Konakawa, sowie den Vorstandsvorsitzenden des Instituts für Psychiatrische Forschung , und wie sich herausstellt, den Widersacher des Films Seijirō Inui kennen. Beide verkörpern hier jeweils eine Funktion des Traums.
1.1 Der Fall „Toshimi Konakawa“
Wir sehen bei Konakawa, wie er immer wieder mit demselben Trauma-behafteten Traum konfrontiert wird, dessen psychotherapeutische Bewältigung mitunter eine zentrale Rahmenhandlung des Films einnimmt. Dieser Traum beginnt in einer Zirkusmanege, in welcher er als ein beobachtender Polizeibeamter die Vorkommnisse im Auge behält und mit Undercover-Agents Absprachen hält, als er mit einem Mal von dem praktizierenden Magier auf der Bühne in einen goldenen Käfig teleportiert wird. Nachdem das schaulustige Publikum, in dem jede Person das Gesicht von Konakawa selbst besitzt, auf die Bühne stürmt, fällt Konakawa durch den Boden und irrt von einer Tarzan-Szene in eine Krimi-, dann in eine Bare-Knuckle-Fight-Szene, bis er in einem Hotelflur endet, in dem er einen Körper zu Boden gehen, und eine Person am Ende des Flurs verschwinden sieht. Sein Versuch, dem vermeintlichen Täter hinterherzueilen wird dadurch verwehrt, dass er mit einem Mal auf der Stelle läuft und sich stattdessen der gesamte Hotelflur unter seinen Füßen aufschiebt, bis der letzte Fetzen Hotelflurteppich erreicht ist, er in die Tiefe stürzt und schließlich aufwacht. Wir erfahren im Verlauf des Films, dass die Motive seiner Polizeiarbeit und die Motive der filmischen Referenzen Teile seines traumatischen Moments sind. So war Konakawa einst Filmenthusiast und hat mit einem Freund einen Kriminalfilm (auf 8 mm, wie er stolz erzählt) gedreht, ist dann aber aus dem Projekt ausgeschieden und hat sich für eine Laufbahn als Polizist entschieden. Währenddessen musste sein Freund das Projekt alleine beenden, wurde auf einer Filmschule akkreditiert, aber verstarb kurze Zeit später an einer Krankheit von der Konakawa nichts gewusst hat. In Schuldzuweisungen verstrickt, seinen Freund alleine gelassen zu haben, konfrontiert der wiederkehrende Traum Konakawa mit diesem Trauma, wodurch das Aufwachen für ihn hier der Konfrontation mit dem Trauma auflöst.
1.2 Der Fall „Seijirō Inui“
Der Vorstandsvorsitzende Inui ist in Realität an einen elektrischen Rollstuhl gebunden, wobei nicht aufgeklärt wird, wieso er an den Rollstuhl angewiesen ist. Die Umstände sind für die Betrachtung allerdings auch nicht relevant, denn dass für Inui ein traumatisches Moment vorliegt, zeigt sich in seinen Taten und Aussagen. In seinem Körperbild, auf der imaginären Ebene, sieht sich Inui mit einem irreversiblen Mangel ausgestattet, welches in ihm ein Begehren auslöst. Als Vorstandsvorsitz weiß Inui von den Potenzialen und Problematiken des DC Minis. In seinem eigenen Körperbild gebrochen sieht Inui in seinem ödipalen2 Mitverschwörer Morio Osanai die Chance auf einen neuen, funktionierenden Körper:
„Meine erhabene Seele braucht diesen Körper, nur wenn die beiden verschmelzen und eins werden, dann, dann werde ich vollständig sein, dann werde ich vollkommen sein, dann werde ich vollendet sein.“
Er weiß, dass diese Verschmelzung lediglich in einer Traumwelt vollzogen werden kann und strebt eine eskapistische Weltordnung der Träume an, muss demnach die gefährlichen Potenziale des DC Minis nutzen, um eine Simulation zu kreieren, in welcher er die Deutungs- und Machthoheit besitzt, wobei er für seine Argumentation ein Wächter-Narrativ wählt. Rhetorisch und diskursanalytische gewiss ein Hüllwort für sein Herrschaftsstreben, für seine Allmachtsphantasie.
“Es liegt in der Verantwortung des Menschen Wissenschaft und Technik zu kontrollieren. […] Einen Traum mit jemand anderem teilen zu können ist ein großer technologischer Fortschritt. Wenn allerdings unsere progressive Technik dazu geeignet ist Gewalt im Traum zu erzeugen, dann wäre es wohl besser, sie wäre nie erfunden worden. […] Er ist fähig dazu Träume zu kontrollieren und im Übermut ergeben sich damit ungeahnte Möglichkeiten.”
Wenn Inui nach der Bekanntgabe des Diebstahls der DC Minis diese Worte äußert, spiegeln sie gleichermaßen seine eigenen Intentionen ab und verrät, indem er Paprika als Terroristin versteht, seine Aversion gegenüber der Idee, dass mit dem DC Mini Macht auch in anderen Händen liegt – wenn auch die Intentionen von Paprika und der Forschungseinrichtung deutlich bei den psychotherapeutischen Möglichkeiten liegen.
1.3 Paprika und die Psychotherapie
Während wir also bei Konakawa sehen, dass es der Traum ist, der ihn mit seinem Realen konfrontiert, ist es bei Inui die réalité manqué in Form des Rollstuhls als allgegenwärtiges Objekt des Traumas, die ihn eine illusorische Traumwelt anstreben lässt, um aus der Realität und dem Realem zu fliehen. Anders als Konakawa verfolgt Inui damit einen ideologischen Traum, wobei ein Traum par définition als Illusion des Bewusstseins keine Realität abbildet, was sich demnach gleichermaßen auf den ideologischen Kern auswirkt. Žižek schreibt dazu:
„Im Traum kollidieren wir mit dem Rahmen der phantasmatischen Identität, der unser Handeln selbst in der wachen “Realität” festlegt. Und ebenso ist es mit den berühmten “ideologischen Träumen”, mit der Auslegung der Ideologie als eines “Traumes”, eines Traumgebildes, das uns für die “wahre Realität” blind macht: Alle Versuche, sich von diesen Träumen zu befreien, indem man “die Augen für die Realität öffnet”, bleiben nutzlos, da wir gerade als Subjekte einer solchen “de-ideologisierten”, “nüchternen”, “objektiven”, “vorurteilslosen” Betrachtungsweise, einer Betrachtungsweise, die “die Tatsachen so erfaßt, wie sie sind”, ständig das Bewußtsein unserer ideologischen Träume bleiben.“3
Als kathartische Praxis um sich vom ideologischen Traum zu lösen nennt Žižek folglich, was gleichsam so auch auf das Trauma anwendbar ist:
„Die einzige Möglichkeit, sich wirklich von den ideologischen Träumen zu befreien, ist die, sich mit dem Realen unseres Begehrens, das sich in ihnen offenbart, zu konfrontieren.“ 4
An diese Stelle tritt das Konzept von der Filmtitel-prägenden Protagonistin Paprika in Kraft. Wir lernen Paprika im Dualismus von Traum und Wirklichkeit schnell als eine Art Traum-Alter Ego von der Psychotherapeutin Dr. Atsuko Chiba kennen, durch das sie Patienten therapiert. Am Präzedenzfall Konakawa zeigt die therapeutische Maßnahme immerhin zum Ende des Films Wirkung. Ein entscheidender Punkt gibt es jedoch, der Paprika von anderen Traum-Personas im Film unterscheidet. So erscheint sie viel mehr als ein Avatar, eine Inkarnation von Chibas rationaler Funktion als Psychotherapeutin. Paprika ist dabei nicht nur ein Pseudonym, sondern besitzt ebenso eine andere Physiognomie. Paprika wird also bewusst von Chiba abgespalten visualisiert, ist bis zum Punkt einer Koexistenz in der Traumwelt aber dennoch Werkzeug ihres Bewusstseins. So kommt es vor, dass sich Chiba in der Gestalt von Paprika im Spiegel sieht. Chiba erfährt durch den Blick in den Spiegel also ein stark verfremdetes Ich, wie es Lacan über das Spiegelstadium determiniert. Paprika hingegen verfügt gleich über gar kein Spiegelbild. Das Spiegelstadium als Schlüsselmoment der Realisation über das eigene Subjekt bleibt Paprika also verwehrt. Für die Lacan’sche Betrachtung ein klarer Verweis darauf, dass es sich bei Paprika um kein eigenes Ich handelt. Darüber hinaus beobachtet Chiba bei sich, in der letzten Zeit nicht mehr zu träumen. Die Umstände Paprika als Avatar der Traum-Therapie zu nutzen scheint demnach mutmaßlich Nebenwirkungen für Chiba zu haben.
Die bis hierhin aufgetauchten Dualismen Traum als Trauma vs. Traum als Eskapismus, Traum und Wirklichkeit, Paprika und Chiba sind jedoch nur solange konsistent, solange sie sich nicht vermischen – ein Umstand der durch die neuen Technologien im Werk nicht nur möglich erscheinen, sondern den zentralen Handlungspunkt ausmacht.
2. Die Hyperrealität der Hochtechnologie
“Heiß brennt der Atem voll unbändiger Freude an diesem Leben. Ich werde niemals zulassen, dass mein heiliger Boden von hochmütiger Wissenschaftstechnologie entweiht wird. […] Die Träume sind verstört, voll von Angst und Schrecken, denn ihre größte Befürchtung ist, dass Wissenschaft und Technik ihre sichere Welt entreißen. […] In einer unmenschlich gewordenen Realität ist der Traum die einzig verbliebene Zufluchtsstätte und damit das Heiligtum der Menschlichkeit. Das letzte Schutzgebiet.“
Diese Worte äußert Inui in seinem Wächter-Narrativ über die Frevel der Psychotherapie sich an den Träumen der Menschen zu vergehen. Bezogen auf Inui sind diese Worte Hypokrisie, da er selbst diesen vermeintlich „heiligen Boden“ seiner Unabhängikeit berauben will, allerdings eröffnet dieses Narrativ eine Kritik an den vorgestellten Technologien zur Psychotherapie. Denn ist das DC Mini und das Eindringen in Träume Fluch oder Segen? Bereits etablierte Diskurse hinterfragen schon seit Jahrhunderten den eskapistische Charakter phantasievoller Medien, aber wenn diese durch die Technologisierung an den Platz der Träume treten, wozu degradiert dann der Traum? Abermals würde sich dann die Frage stellen, wie sinnvoll und fruchtbar es wäre Träume zu pathologisieren und ob nicht gefährliche Indoktrinationspotenziale mit dem Missbrauch vorliegen würden.
2.1 Zwischen den Welten
In „Paprika“ ist es interessant zu beobachten, wie der zuvor noch genannte Dualismus von Traum als Illusion und Realität als dingliche Wirklichkeit durch den Missbrauch des DC Minis aufgebrochen wird. Uns wird im Baudrilliard’schen Sinne ein Simulakrum präsentiert. Eine Welt, welche die Realität als zeichenorientiertes Vorbild hat und doch für sich steht; eine Welt, die hier liminal zwischen Wirklichkeit und Traum liegt. Für die Beschaffenheit dieses Simulakrums bedeutet, dass sich für die Akteure eine kaleidoskopische Welt eröffnet, die in einem einzigartigen visualisierten Spiel mit der medialen Umgebung dem Brecht’schen Verfremdungseffekt unterliegt.5 Das Simulakrum in Paprika stellt also eine liminaler Hyperrealität dar, in der die Realität und traumhafte Phantasie aufeinanderstoßen und ununterscheidbar werden. So können sich die Protagonist*innen ab einem Punkt selbst nicht mehr gewiss über den Status ihrer wahrgenommenen Wirklichkeit sein. Überall finden sich Imaginationen denen ein überbordenden, flamboyanten Zeichensystems anhängt, und die in einer riesigen, unaufhaltsamen, chaotischen und mitreißenden Parade zusammenkommen. Der DC Mini als katalysierende Schlüsseltechnologie steht mit seinen Folgen also repräsentativ für die Bandbreite der diversen digitalen Technologien um Virtualität, der omnipräsente Interkonnektivität und den damit begünstigten Konsum. Ein Simulakrum zeichnet sich also explizit dadurch aus, dass sich die Zeichensysteme nicht länger dichotom verhalten, was die Austauschbarkeit der Pole begünstigt. Baudrillard konkludiert dies mit bemerkenswerter zeitgenössischer Aktualität:
„Das Zeitalter der Simulation wird überall eröffnet durch die Austauschbarkeit von ehemals sich widersprechenden oder dialektisch einander entgegengesetzten Begriffen. Überall die gleiche Genesis der Simulakren: die Austauschbarkeit des Schönen und des Häßlichen in der Mode6, der Linken und der Rechten7 in der Politik, des Wahren und Falschen in allen Botschaften der Medien8, des Nützlichen und Unnützen auf der Ebene der Gegenstände, der Natur und der Kultur auf allen Ebenen der Signifikation.“9
2.2 Kritik der massenmedialen Hochtechnologie
Paprika bringt die Allegorie zwischen Träumen und den virtuellen Technologien des Internets selbst zur Sprache, als sie zu Konakawa sagt:
„Findest du nicht auch, dass Träume und das Internet sich in gewisser Weise gleichen? In beidem lebt sich das unterdrückte Unterbewusste aus.”
Vorher betritt Konakawa durch seinen Internetbrowser über eine entsprechende Domain die Bar, in der er hofft Paprika zu treffen. Die phantastische Virtualität wird dort also mithilfe des DC Mini mit der Traumebene verknüpft, was die Gemeinsamkeit zum Imaginären beider Bereiche verdeutlicht. Dass das unterdrückte Un(ter)bewusste im Traum zum Ausdruck kommt, wurde am Fall von Konakawa bereits eruiert. Dass es sich ebenso für das Internet, oder Medien im Allgemeinen, verhält, ist eine These Paprikas, die der angesprochenen Ähnlichkeit von Traum und Virtualität entspringt und bei welcher der Fall von Inui folglich ausschlaggebend wird. Die These verweist damit also wieder auf den Eskapismus-Charakter, welcher verschiedensten Medien, der Informationsflut und Massenkonsumgütern zugesprochen wird. Für Baudrillard sind die unidirektionalen Massenmedien geprägt von Nicht-Kommunikation, einer hierarchischen Oktroyierung, die in sich keine Differenzierung erlaubt. Personen, die bereits in der walzenden Parade in der Traumwelt verschollen sind, werden im Film darin beschrieben, kein Bewusstsein mehr zu haben: „Sie träumen nicht, obwohl sie in der REM-Phase sind.“ merkt Dr. Toratarō Shima, der leitende Arzt der DC Mini-Entwicklung, an, woraufhin Chiba entgegnet: „Es ist fast so, als ob ihr Bewusstsein entfernt worden wäre.“ Später beschreibt Chiba ein Opfer des DC Minis zudem als „eine Art von Kokon, aber ohne Innenleben. Sein Bewusstsein ist durch die große Flut an Träumen komplett ausgehöhlt worden.“ Dies ist nahezu eine zynische Allegorie auf die gleichgültige, lethargische Position der äußeren Konsumgesellschaft mitsamt technologischen Anhangs, welche durch die ekstatische und chaotische Bilder einer lähmenden Reizüberflutung unterliegen. Im Werk wird angemerkt, dass die Traumwelt mit der angesprochene Parade Projektion eines an Größenwahn leidenden Patienten ist. Wir wissen von Inui als Initiator und Ausgangssubjekt dieser Traum-Oktroyierung und wissen von seiner Größenwahn-gleichenden Allmachtsphantasie, die er mit dem Wächter-Narrativ verschleiert. Die Traumwelt ist demnach ebenso konstruiert wie die Massenmedien: unidirektional und hierarchisch. Indem wir also das Zitat zu Beginn des Kapitels für sich betrachten, ohne die Hypokrisie Inuis die sich dahinter verbirgt, offenbart sich die legitime, wenn auch kulturpessimistische, Kritik an technologischer Entwicklung, die durch Virtualität eine eskapistische Hyperrealität provoziert und durch seine unidirektionalen Strukturen einer Gleichheit der Subjekte vorbeugt, wie sie Baudrillards bereits äußerte.
3. Schluss
Der zuletzt betrachteten Kritik zum Trotz findet „Paprika“ ein Happy-End durch die Destruktion der Hyperrealität, wodurch Traum und Wirklichkeit wieder getrennt sind.
„Für das Dunkel gibt es das Licht, für den Traum die Realität, für den Tod das Leben und für den Mann gibt es…“
Paprika, als Protagonistin, benennt Dualismen, indem die Frau als Gegenpol zum Mann genannt wird. Es ist klar, dass all diese Dualismen letztlich wenig dichotom sind, sondern, wie wir anhand der Traum-Realität-Dichotomie gesehen haben, von Schattierungen gekennzeichnet sind. Sich aber die Dualismen vergegenwärtigend, wendet sie sich Paprika antagonistisch gegen Inuis gottgleiche Gestalt und verleibt ihn sich mitsamt allen Versatzstücken der Traumwelt ein. Die Vergegenwärtigung der Dualismen dient hier viel mehr der Besinnung auf ein konsensuell absolutes Zeichensystem, auf einen ursprünglichen harten Kern, der mit der Realität verbunden ist. Žižek spricht im Kontext von Lacan von der unhaltbaren Idee des universalisierten Traum, welcher dem Konzept der ideologischen Hyperrealität gleicht. Žižek schlussfolgert:
„[Es] bleibt immer ein “harter Kern” übrig, ein Überrest, der sich dem universalierten Spiel illusorischer Spiegelungen entzieht: der Unterschied zwischen dieser Schlußfolgerung und dem “naiven Realismus”, der an die “harte Realität der Tatsachen” glaubt, liegt nur darin, daß sich hier der zuvor erwähnte “harte Kern” gerade im Traum offenbart.“10
Damit scheitert das Vorhaben Inuis und Osanais, eine hierarchische Hyperrealität zu schaffen, aber das DC Mini und die Technologisierung sind gegenwärtig und auch, wenn die Nutzung und Entwicklung in diesem Fall vielleicht optimiert oder gar untersagt wird, sehen sich die Protagonisten in einer Welt, die stets von neuen Technologien und Medien in ihrer Realitätskonstruktion bedroht werden könnten. Am Beispiel von „Paprika“ zeigt sich, dass neuen Technologien und ihren Medien meist sowohl utopische, als auch dystopische Funktionen anhaften. Umso ironischer erscheint es, dass Inui den Umstand auf den Punkt bringt, dass die Weise der Nutzung am Ende in den Händen der Menschen liegt und damit ihr Wesen offenbaren. Demnach bleibt es mir nur das in 1.3 genannte Zitat zu wiederholen:
„Es liegt in der Verantwortung des Menschen Wissenschaft und Technik zu kontrollieren. […] Einen Traum mit jemand anderem teilen zu können ist ein großer technologischer Fortschritt. Wenn allerdings unsere progressive Technik dazu geeignet ist Gewalt im Traum zu erzeugen, dann wäre es wohl besser, sie wäre nie erfunden worden.“
4. Literatur
Baudrillard, Jean (1978): Requiem für die Medien. In: Jean Baudrillard: Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen. Berlin: Merve Verlag.
Baudrillard, Jean (1982): Der symbolische Tausch und der Tod. München: Matthes & Seitz.
Lacan, Jacques (2005): Ecrits. A Selection. London, New York: Routledge Classics.
Stehle, Samuel (2012): Zur Aktualität von Jean Baudrillard. Einleitung in sein Werk. Wiesbaden: Springer VS.
Žižek, Slavoj (1991): Liebe dein Symptom wie dich selbst! Jacques Lacans Psychoanalyse und die Medien.
Žižek, Slavoj (2019): Lacan. Eine Einführung.
Anmerkungen
1Das Reale ist bei Lacan eine der drei konstitutiven Kategorien der Psyche und nicht synonym zum Begriff “Realität” zu verstehen. Realität meint gegenüber dem Realen den Horizont der wahrnehmnaren Wirklichkeit.
2Osanai erscheint im Lacan’schen Sinne ödipal. Dabei sieht er in der Kooperation mit Inui, wie sich herausstellt, die Möglichkeit Atsuko Chiba als sein Objekt des Begehrens gewaltsam anzueignen, nachdem er auf der Basis der Wirklichkeit kein sexuelles Interesse bei ihr weckt. Für sein Begehren unterwirft er sich auf symbolischer Ebene den Willen Inuis zum Zweck der angestreben Traumwelt als Gesetzmäßigkeit, als großes Andere, als Vater.
3Žižek (1991): 115
4Ebd.
5Für eine zugängliche Auseinandersetzung mit dem eindrucksvollen, transmedialen Editing in Satoshi Kons Filmen empfehle ich das Videoessay des Youtube-Kanals Every Frame a Painting.
6Stichwort “Ugly Fashion”
7Sichtwort “Hufeisentheorie”
8Stichwort “Fake News”
9Baudrillard (1982): 20
10Žižek (1991): 115