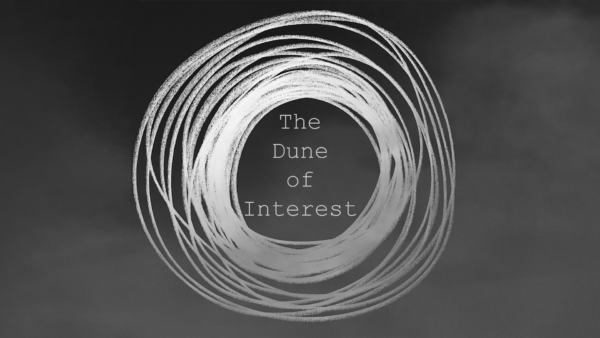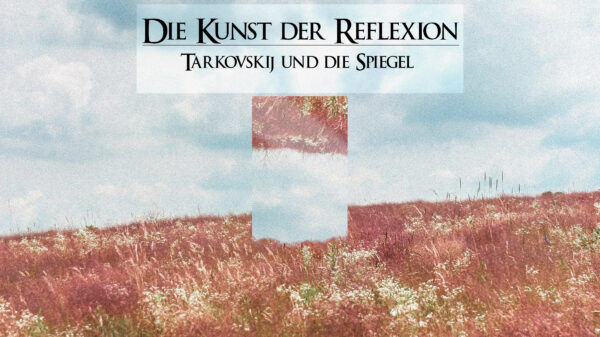Der sowjetische Science-Fiction-Film “Gibel’ Sensacii” (Гибель сенсации) von Aleksandr Andrievskij (Александр Андриевский) aus dem Jahr 1935 handelt von und um den jungen Ingenieursstudenten Jim Ripple. Durch seine technologische Errungenschaft der Roboter sieht Ripple, stammend aus proletarischen Verhältnissen, die Chance, die Bürden der harten Industriearbeit bei seinen Familienmitgliedern durch androide Arbeitskräfte zu entlasten. Durch die drohende Arbeitslosigkeit in einer vom Prekariat geprägten Gesellschaft erfährt Jim Ripple hingegen ausdrückliches Missfallen aus den familiären Kreisen, während die politischen, militärischen und großindustriellen Bourgeois in der Überwindung menschlicher Arbeitskraft eine Chance zur Produktionsoptimierung sehen. Von der Arbeiterfamilie verstoßen und von sich selbst überzeugt kooperiert Jim Ripple mit der herrschenden Klasse, um die R.U.R. (Ripple’s Universal Robots1) zu konstruieren, die wiederum entgegen Jims ursprünglichen Sinn nicht nur als Arbeitskraft, sondern in einem folgenden Klassenkampf für Dienste des Militärs gegen die Arbeiter*innen instrumentalisiert werden. Nur durch die Organisation der Arbeiter*innen und den wenigen Akteure mit technischem Verständnis in ihren Reihen gelingt es den Arbeiter*innen am Ende, sich die R.U.R. anzueignen und sie gegen das Militär und die Obrigkeiten zu richten.
Der Film lässt sich in Gänze und mit Untertiteln auf Youtube abrufen.
Mit der Gratwanderung des Protagonisten Jim Ripples zwischen Bourgeoisie und Proletariat und einem individuellen Utopieverständnis folgend, entwirft “Gibel’ Sensacii” eine Narrative, geprägt von postmarxistischen und psychoanalytischen Motiven, wie sie in der poststrukturalistischen Strömung zusammenlaufen und weitergedacht wurden. Rezipienten von Marx und Lacan, wie Louis Althusser und Slavoj Žižek2, ermöglichen dabei einen Blick auf den Film, der die soziale Umwelt von Jim Ripple und seine ideologische Position in dem geschilderten Spannungsverhältnis in einen Gesamtzusammenhang setzt und zu einem Deutungsversuch ermuntert. Obwohl der Poststrukturalismus epochal nicht im direkten Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieses Films steht, nimmt der Poststrukturalismus Bezug auf fundamentale Gesellschaftssysteme der Moderne, wodurch er eine retrospektive Betrachtung von der Lebensrealität in „Gibel’ Sensacii“ zulässt.
1. Der produktionsbedingte und ideologische Rahmen
1.1 Das Dilemma mit der Reproduktion
Zu Beginn des Films wird uns bereits eindrücklich vermittelt, dass “Gibel’ Sensacii” in einer Industrienation spielt, die von prekarisierten Dynamiken gezeichnet ist. So finden sich am Hafen der Stadt diverse Menschen zusammen, die trotz der vermittelten Kälte dort mit Decken und in Gebäudenischen versuchen zu schlafen. Jim Ripple und seinen Kommilitonen Hamilton Grim lernen wir im Folgenden in einer Fabrik bei einem Experiment kennen. Sie beobachten dabei die Auswirkung auf die Produktionseffizienz bei der Beschleunigung des Produktionsprozesses an den Fördermaschinen, dem ein Arbeiter*innen nicht standhält. Während Jim noch vor dem Experiment anmerkt, dass die angedachte Geschwindigkeitserhöhung illegal sei und von dem Zusammenbruch des Arbeiters schockiert ist, kommentiert Hamilton den Unfall damit, dass proletarische Nerven doch weitaus stärker sein müssten. In dem darauf stattfindenden Barbesuch von Jim in einem gehobenen Etablissement, bekommen wir neben einem Eindruck von der gehobenen Gesellschaft, den Umstand präsentiert, dass sich auch dort Apathie und Krise wiederfindet. So erfahren wir von einem Gespräch, dass sich zuletzt mehrere Bänker suizidiert haben sollen. Die Jim dort präsentierte mechanische Puppe gibt ihm dort folglich die Idee zur Entwicklung androider Roboter im Dienste der Arbeitskraft. Während sich Jim nach seinem Arbeitstag und dem Barbesuch auf den Weg nach Hause macht, trifft er zudem auf seinen alten und verarmten Freund Bill. Sie sprechen über Bills Erfindung, die keine Abnehmer findet, da sie wohl keine militärischen Zwecke bedient. Stattdessen mahnt Bill Jim, dass ihm dasselbe hungerleidende Schicksal ereile, wenn er weiter im Land bleibt. Bereits diese ersten Eindrücke gepaart mit den im weiteren Film geschilderten Verhältnisse von Proletariern und Bourgeoisie zeichnen weitestgehend ein klassisches marxistisches Bild industrialisierter Gesellschaftsformationen. Auf der einen Seite stehen eben die Kapital- und Produktionsmitteleigner; auf der anderen Seite die lohnarbeitenden Produktionskräfte. Die reziproke Abhängigkeit beider Seiten zeigt sich unverkennbar. In der angesprochenen Barszene reden Bourgeois ebenso davon, von der Großindustrie wieder zurück zur Manufaktur zurückzukehren, aber auch in den besagten Fabriken werden menschliche Arbeitskräfte für diverse Arbeitsschritte noch gebraucht. Die Arbeiter*innen hingegen zeigen sich in ihrer Existenz bedroht, als sie erfahren, dass ihre Stellen gekürzt werden und damit ihr Lohn minimiert wird. Obgleich diese verankerten Abhängigkeiten bei einigen Charakteren zu Missmut führen, sind sie letztlich nicht von der Hand zu weisen und fester Bestandteil des im Film konstruierten, kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Die Krise, die sich im Film herauskristallisiert lässt sich dahingehend erklären, dass die Produktionsbedingungen (bestehend aus Produktionsmittel und Arbeitskraft) drohen, sich nicht mehr reproduzieren zu können. Wie auch Marx legt Althusser dem System theoretisch zugrunde, dass die kapitalistischen Produktionsweisen für die Ökonomen derartiges Kapital erwirtschaften müssen, dass sich die Produktionsmittel, also Rohstoffe, Gebäude, Produktionsinstrumente, finanziell reproduzieren können, damit sich die Produktion perpetuiert und zusätzlich dazu Wachstumspotenzial ergibt. Die Reproduktion der Produktivkräfte erfordert zusätzlich Lohn, um ihre Existenz zu gewährleisten und gleichzeitig durch Kinder neue Arbeitskräfte großziehen zu können. Diese Grundannahme verdeutlicht die im Film stattfindende wirtschaftliche Abwärtsspirale und die einhergehende Prekarisierung. Ein konkreter Auslöser dieser Abwärtsspirale bleibt im Film unerwähnt. Was wir von der Begegnung mit Bill am Anfang erfahren ist, dass militärische Güter priorisiert und anderweitigen Innovationen keine Beachtung geschenkt werden. Zudem liegt der Überwindung menschlicher Arbeitskraft deren eventuell mangelnde Effizienz für die bestehenden Zirkulationsverhältnisse zugrunde. Das würde das Experiment zu Beginn des Films erklären, wobei die Schließung von Fabrikbetrieben dieser Annahme paradox entgegenstände. Über die politischen Gesamtzusammenhänge bleiben wir also partiell im Dunkeln, erfahren aber durch die Zusammentreffen der Bourgeios die Grundzüge des Staatsapparates.
1.2 Repression und Ideologie
Marx spricht beim Staat von einem repressiven Apparat, eine unterdrückende Maschinerie, “die es den herrschenden Klassen […] erlaubt, ihre Herrschaft über die Arbeiterklasse zu sichern, um sie dem Prozeß der Abpressung des Mehrwerts […] zu unterwerfen”3. Althusser unterzieht dem Staat und seinen Institutionen hingegen eine Unterteilung in die zwei Pole des ideologischen und repressiven Staatsapparats. Der repressive Staatsapparat folgt dem Verständnis von Marx, so bündeln sich darunter vorwiegend Institutionen mit repressiven Mitteln, wie Polizei, Militär, Gerichte und Verwaltungen, also mit unmittelbarem Zugriff zur Gewalt über jeden Einzelnen. Unterliegt dem repressiven Staatsapparat also eine Funktion der Oppression, liegt bei dem ideologischen Staatsapparat vielmehr eine Unterwanderung vor, die auf vielen Ebenen stattfinden kann und sich im Gegensatz zur Oppression nicht unmittelbar zeigen muss. Dabei dienen diverse Institutionen religiöser, bildender, politischer, aber auch familiärer Nuancierung als Einflussfaktor in der Sozialisation jedes Einzelnen und werden damit ideologiestiftend. Die herrschende Klasse, die nun nicht ganzheitlich, aber partiell, Hoheit über die genannten Institutionen hat, kommuniziert somit auch die herrschende Ideologie, oder tut zumindest ihr Möglichstes daran. Da sich der ideologische Staatsapparat eben privater und feingliedriger zeigt, und die Ideologie kein so direktes Instrument ist wie die Gewalt, ist die Installation der Ideologie durch den entsprechenden Apparat nämlich weniger simpel zu bewerkstelligen.
Eingebettet in die Reproduktion der Produktionsverhältnisse wird die Repression theoretisch nur als Rahmen staatlicher Sicherheit gebraucht. Um die laufenden Produktionsverhältnisse und ihre konstituierenden Verhältnisse (im Film die Dichotomie zwischen Bourgeoisie und Proletariat) zu legitimieren, also die Grundpfeiler der im Film gezeigten kapitalistischen Gesellschaft aufrecht zu erhalten, rückt folglich in den Aufgabenbereich des ideologischen Staatsapparates. Ein Beispiel eines ideologischen Apparats ist die Schule, in der nicht nur Wissen vereinheitlicht wird, sondern auch eine Bildungsselektion zwischen den einzelnen Akteuren vorgenommen wird, wodurch der Bildungsweg heruntergebrochen in zwei Wege geteilt werden kann: Einmal in den Weg der einfachen Arbeiter und einmal in den elitären Weg, der im Staatsapparat oder in der Bourgeoisie endet.
Dass wir zuvor festgestellt haben, dass die Reproduktion in dem im Film gezeigten Staat desolat und der Kapitalismus sich dort in einer Krise befindet, lässt sich nach Betrachtung der repressiven und ideologischen Funktionsweisen eine Überrepräsentation von repressiven Strukturen nachweisen. Hamilton Grims Vater, der ein hohes politisches Amt bekleidet, umgibt sich neben Kapitalisten vorrangig mit dem Militär, dem Hamilton selbst zugehörig ist, wie seine Uniform zum Anlass der Präsentation der R.U.R. verrät. Die anwesenden Arbeiter sprechen von Hamilton selbst als einem “fascist”, als sie Jack nach Verkündung der Fabrikschließung im ersten Drittel des Films davon erzählen, dass sein Bruder bei dem Experiment zu Beginn dabei war. Der Staatsapparat erweckt im Film demnach einen stark militarisierten und damit repressiven Charakter, der im Verlauf des Films schließlich das Proletariat als zu dezimierendes Ziel deklariert. Es ergibt sich also, dass nicht nur die kapitalistische Wirtschaft im Film in einer Krise steckt, sondern, dass hinzukommend, die staatliche Basis vordergründig repressive Züge annimmt und dadurch die ideologische Konstituente bröckelt. „Have you forgotten about the prison, police and unemployment?“, fragt Jack seinen Bruder, nachdem er den ersten Roboter „Micron“ vorstellt. Die Repression ist in den Köpfen der Arbeiter*innen vorherrschend und unser höherqualifizierte Protagonist Jim wiederum reflektiert all diese Entwicklungen mit Besorgnis und fasst daraus seine eigene Schlussfolgerung und seinen eigenen Lösungsansatz.
2. Der Fall des Jim Ripple
2.1 Jims Realität und die Nicht-Revolution
Wir haben nun also erfahren, dass der nationale Schauplatz im Film von einem desolaten System geprägt ist. Jim konstruiert sich und seine Idee der androiden Arbeitskraft in diesem Konflikt als Erretter. Dabei sind seine Ziele vordergründig antikapitalistisch. Im Gespräch mit seiner Schwester sagt er:
„I’ll become an engineer only because of you and Jack. But is this a solution? It’s not for everyone. And the capitalists are trying to make us their assistants, all of us. […] We need to destroy the [foundation] of this working question, and capitalism as a result.“
Und weiter:
„You see Claire, we have to destroy capitalism. We need a revolution in this nowhere going country. And in the country where the machines are developed, it will die itself! Without any revolution. And you know Claire? I think I am able to create this revolutionary thing – the one that will change the whole world.“
Nachdem er seiner Familie dann zur Feier seines Abschlusses seinen ersten Roboter präsentiert und sein Bruder Jack ihn fragt, für wen das sein solle, schildert Jim:
„It’s for you! Capitalism makes a tool for enslavement out of any machines. The machines invade in people’s life. And I am going to make the step in technical development which will change everything. I have created an automatic device which can do anything. He will easily replace all the workers an any factory. What will happen? The World Market will be overfilled. The prices will decrease. And without any revolution the capital itself will not exist any longer.“
Wenden wir uns im folgenden einer psychoanalytischen Betrachtung Jims im lacanschen Sinn zu. Dabei dient Lacans Psychoanalyse nicht dem Zwecke der Behandlung psychischer Anomalien. Žižek bringt die lacansche Psychoanalyse auf den Punkt, indem er sie als „Theorie und Praxis, die die Individuen mit der radikalsten Dimension der menschlichen Existenz konfrontiert“4, beschreibt. Die Aufgabe liegt nicht darin, die betrachteten Akteure in eine normative soziale Realität einzubetten, sondern zu eruieren, wie sich die Realität der Akteure zusammensetzt. Ein, wenn nicht der Grundpfeiler lacanscher Psychoanalyse ist dabei die, Trias von „Dem Realen, dem Symbolischen und dem Imaginären“.
In Anbetracht der oben zitierten Dialogpassagen sieht Jim seinen Karriereweg altruistisch motiviert und, wie der Film fortlaufend zeigt, übersteigen seine Überzeugungen die Bindung zur Familie. Wenn man nun die Psychoanalyse Lacans hinzuzieht, befindet sich diese Selbstwahrnehmung Jims im Bereich des Imaginären. Es beschreibt das Ideal-Ich; das illusorische und idealtypische, narzisstisch getriebene Selbstbild eines Subjekts. Jim sieht sich in der Verantwortung und mit dem Bildungsstand ausgestattet, alleine und nur durch seine Erfindung die kapitalistische Gesellschaftsordnung umzuwerfen. Als verkannter Held wendet er sich bewusst seiner Arbeiterfamilie ab, um diese vom vermeintlich glorreichen Nutzen seiner Erfindung zu überzeugen. Dieses Selbstbild wird ideologisch durch Jims Position zwischen den Welten der Bourgeoisie und des Proletariats untermauert. Denn seine Intention ist aus proletarischer Sicht marxistisch. Jim erkennt die sklavische und entfremdende Wirkung der Fabrikarbeit auf das arbeitende Individuum und möchte dieses Individuum durch seine Erfindung schützen. Althusser spricht von Anrufung wenn eine Ideologie auf ein Subjekt wirkt und dieses zum Handeln ermutigt. Die Anrufung, der Jim hier demnach folgt ist nicht kapitalistisch, obgleich seine Umsetzung kapitalistische Strukturen benötigt. Die eigentliche Anrufung, der Jim folgt ist die marxistische, dessen Bewusstsein er durch seine proletarische Sozialisation überhaupt erst erworben haben wird.
Nach Lacan ist es die symbolische Ebene, also die Ebene Sprache, die die Illusion des Imaginären erst zu brechen vermag. Die Sprache, die in der Semiotik arbiträr zugeordneten Signifikaten, also willkürlichen symbolischen Zeichen, entspringt, erzeugt eine Form des Transfers nach außen, der dem Bild des Imaginären nicht gerecht wird. Dabei können Nuancen des Unbewussten in Sprechform nach außen dringen und unbewusste Ziele verdeutlichen. Dass diese Nuancen durch eine fehlerhafte Übersetzung im Film verschleiert werden können, sei hier angemerkt. Betrachten wir den Dialog aber dennoch, so fällt auf, dass Jim eine Revolution ohne Revolution anstrebt: „We need a revolution […]. Without any revolution“. Diesem Oxymoron liegt die innewohnende Mehrdeutigkeit von „Revolution“ zu Grunde, dass einmal ein bloßer struktureller Wandel bedeuten und einmal die Revolution unter Einbezug eines umstürzenden Klassenkampfes meinen kann. Jim vermutet durch seine Erfindung eine schleichende Revolution und einsetzende Obsoleszenz und Überwindung des Kapitals, der damit einhergehenden Produktionsbedingungen und der gesellschaftlichen Ordnung. Gewissermaßen liegt hier bei Jim ein neoliberales, marktfundamentalistisches Bewusstsein vor, dem das umstürzenden Eingreifen in den Markt von außenstehenden Akteuren und Institutionen zuwider erscheint. Der Markt soll sich mit Hilfe der R.U.R. selbst abschaffen, was so für Jim unweigerlich eine Kooperation mit den Marktmächten, der Bourgeoisie bedeutet. Repräsentiert der imaginäre Bereich also eine marxistisch-proletarische Position, wird bei Jim im symbolischen Bereich sein Vorgehen von der Marktkonformität geprägt. Lässt das Imaginäre also die Vermutung offen, ob es sich bei Jim um einen marxistischen, revolutionären Denker handelt, erweckt das Symbolische aus marxistischer Erwartungshaltung den Eindruck eines Revoluzzers; eine Lebensrealität gefangen zwischen den beiden dichotomen Welten der Bourgeoisie und des Proletariats. So schimpft letztlich auch Jims Bruder Jack: „You fool! Trying to make peace between two different worlds.“
2.2 Ripples Universal Robots
Außerhalb vom Imaginären und Symbolischen liegt das Reale und ist wohl am abstraktesten zu fassen. Es ist nicht mit der Realität gleichzusetzen, sondern meint ein im Subjekt unbewussten und unaussprechlichen Zustand, der nicht über das Symbolische oder das Imaginäre kommuniziert werden kann. Dem Realen kann beispielsweise ein Trauma zu Grunde liegen, welches sich vom Subjekt abgekapselt hat und an das man sich nicht zu erinnern vermag. In der freudschen Psychoanalyse entspringt der Betrachtung des Realen die Traumdeutung und versteht den Traum als Kanal zum subjektiven Unbewussten. Jim in Hinsicht auf das Reale zu betrachten, bietet sich demnach nicht direkt an. Ein Teil des Realen manifestiert sich jedoch in dem, was Lacan Jouissance nennt. Übersetzt mit „Genießen“, beschreibt Jouissance die oft – aber nicht ausschließlich5 – sexuelle und banale Bedürfnisbefriedigung. Das Genießen beschreibt dabei aber nicht den Zustand, der nach der Befriedigung einsetzt, sondern gleicht vielmehr dem fast schon fetischistischen Prozess, den Höhepunkt des Genusses herauszuzögern, wodurch der Jouissance ein leidender, schmerzerfüllter Charakter obliegt.
Wie bereits eruiert, sieht sich Jim in einer besonderen Position, und zwar der des verkannten Helden mit dem unstillbaren Willen seiner ideologischen Vorstellung über seine familiäre Zugehörigkeit hinweg zu folgen, um mit seinen Mitteln die kapitalistische Ordnung zu überwinden. Das heißt aber nicht, dass er sich seiner Familie abwendet. Was ab dem Zeitpunkt seiner Abkehr von der Familie aber an Relevanz gewinnt, ist der gar rechthaberische Charakter, der bei Jim einsetzt. Er gibt dem Narziss seines Imaginären mehr Raum als den Einwänden aus dem familiären Kreis und findet Genießen in der Dominanz und Korrektheit seiner Idee, seiner Ideologie. Im Film lässt sich das an bestimmen Szenen verdeutlichen: Nachdem die Produktion der R.U.R. in geheimen Fabriken von statten geht, will die Regierung die Produktion beschleunigen und eine weitere Fabrik in Betrieb nehmen. Der Offizier, der Jim über das Telegramm mit dieser Information in Kenntnis setzt, schlägt Jim die Fabrik in „Big Lights“, die Fabrik in der Heimat seiner Familie vor und Jim willigt ein. Die Entscheidung fällt für Jim bewusst, da er dadurch nach längerer Zeit wieder mit seinem Bruder konfrontiert wird. Nach längerer Zeit, in der Jim in seiner Sache erfolgreich war und Reputation geerntet hat. Darauf kontaktiert Jim auch seine Schwester Claire, trifft sie und präsentiert ihr seine Kreationen mit einer für sie einschüchternden und beängstigenden Situation. Nachdem Jim seine Schwester mit einem R.U.R. bedrängt, tut er das als „Witz“ ab, präsentierte er ihr damit doch nur auf energische Weise seinen vermeintlichen Erfolg. Später, nach einer drohenden Auseinandersetzung zwischen Arbeiter*innen und Soldaten vor der Fabrik, wird eine Delegation durch die Fabrik geleitet, um den Arbeiter*innen zu vermitteln, dass die R.U.R. nur als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Jack, der sich in dieser Delegation befindet, trifft hier in der Fabrikhalle auf Jim, welcher die arbeitenden R.U.R. steuert. Jim, der von seiner Empore herab auf seinen Bruder schaut, offenbart ein kurzes Schmunzeln, welches schnell von der durch und durch ernsten Miene seines Bruders gebrochen wird. Dieses Schmunzeln kann erfreulicher Natur sein, kann aber ebenso als neurotische Nach-Außen-Kehrung seines Genießens der erhöhten Position verstanden werden. Zuletzt entschließt sich Jim dann noch, zu den Arbeiter*innen zu sprechen. Aber nicht in persona, sondern durch einen R.U.R. und seine integrierte Sprachübertragung. Wie zuvor bei seiner Schwester führt er hier im großen Stil seine Kreation den Arbeiter*innen vor, sorgt damit für Furcht, Skepsis, Neugier und letztlich unbeabsichtigt für Verzweiflung und Todesangst, als sein Freund Charlie von dem R.U.R verletzt wird.
Die Wirkung und der Nutzen der R.U.R. spielt für Jim in seinem Prozess des Genießens eine fundamentale Rolle. Um die R.U.R. formiert sich aber nicht nur Jims reale Ebene, auch seine imaginären und symbolischen Ebenen kreisen um die R.U.R. und stehen mit dieser seiner Kreation in Interdependenz. Für Jim werden die R.U.R. folglich zu einem Symptom. Das Symptom ist dabei ein Signifikant, eine symbolische Einheit, die für das Genießen konstitutiv ist. Nach dem unglücklich gelaufenen Treffen mit seiner Schwester, wo er ihr die R.U.R. vorstellt, betrinkt sich Jim, um dann in einem Zustand des Deliriums zusammen mit seinen R.U.R. zu tanzen. Ein Moment, wo er im Žižekschen Sinne beginnt, sein Symptom wie sich selbst zu affirmieren6 und die R.U.R. zu einer Kompensation seines familiären Umfeldes und zur Projektion seines nun mehr einzigen lieb gewonnenen Umfeldes werden. Denn sein Wille zum Genuss nimmt besagte, neurotische Züge an, wo die schmerzerfüllten Antipathien seiner Familie auf ihn einprallen, befeuern aber die Jouissance am Ende als die Person dazustehen, die im einstigen Zwist Recht hatte. Die R.U.R. sind für Jim also bis dahin fundamentale Katalysatoren der Jouissance, wie sie aus Konsumentensicht durchweg der Katalysator für die Filmhandlung sind. Die R.U.R. treten also als ein Symptom für das Ziel des Genießens in Erscheinung. Gleichzeitig erscheinen sie als ein unmittelbares Resultat seiner (ideologischen) Reproduktion, sind also förmlich Sprösslinge seines ideellen Revolutionsgedanken.
2.3 Vom lebenden zum toten Subjekt
Ein fundamentaler Punkt, den wir bis hier hin Revue passieren lassen können, ist die Zwei-Spaltung Jims. In der poststrukturalistischen Betrachtung des Subjekts und der Subjektivierung von Individuen zu selbstreflexiven, metaphysischen Existenzen, sieht Žižeks das Subjekt als gespalten in das Bewusste und Unbewusste, die jeweils synchron im Subjekt präsent sind. Žižeks unterscheidet hier auch genauer zwischen dem bewussten Gehorsam und dem unbewussten Begehren, wobei das erstere im Rahmen konventioneller Codes agiert und letzteres konträr der Gesetze agiert um „in die Jouissance einzutauchen. Bei Jim beobachten wir diese Spaltung einmal, dass er in seinem ideologischen Konstrukt zur Überwindung des kapitalistischen Systems bewusst und innerhalb der Marktkonformität handelt. Er beugt sich also wie in 3.1 konstatiert dem kapitalistischen Gehorsam indem er die Revolution ohne Revolution anstrebt. Das Begehren, bislang noch nicht erwähnt, ist nicht mit der Jouissance gleichzusetzen. Die Jouissance ist, wie oben benannt, der Prozess zur Befriedigung der Bedürfnisse, während man das Begehren als Bedürfnis selbst verstehen kann. Das bewusste Begehren kann man durchaus aus dem Kern von Jims imaginären Bereich entnehmen und steht zum Gegenpol des bewussten Gehorsams als die Überwindung des Kapitalismus zum Wohle der Arbeiterklasse. Das unbewusste Begehren aber findet sich, wie herausgearbeitet, viel mehr in dem überbordenden Narzissmus Jims, mit seiner Idee alleinig die richtige Lösung zu haben und sich in nahezu selbst überschätzender Form für den alleinigen Erlöser zu halten. Dieser Narzissmus nimmt Züge eines radikalen Begehrens an. Žižeks hingegen, versteht dieses radikale Begehren als den Todestrieb und damit als eine „negative Geste, die den Raum für die kreative Sublimierung freimacht“7. Die kreative Sublimierung, also die Triebenergie hinter dem Todestrieb geht von Jims Schaffen als Ingenieur der R.U.R. und dessen Intention aus. Was Jim selbst nicht als negative Geste versteht, führt jedoch letztlich dazu, dass er gleich zwei Tode stirbt, wie es Lacan ausdrücken würde. Wie Žižeks schreibt, liegt hier der „Unterschied zwischen realen, physischen Tod (als biologische Tatsache) und den symbolischen Tod als eine ‚Begleichung der symbolischen Rechnungen‘“8. Žižeks verdeutlicht den symbolischen Tod ferner an der christlichen Beichte, welche die beiden Tode dadurch aufeinander abstimmen soll, als dass die symbolische Rechnung durch die Beichte beglichen wird. Der symbolische Tod kann also durch einen kathartischen Moment in Gegenwart des Gläubigers geläutert werden, während der physische Tod unwiderruflich ist. Bezogen auf das (Ab)Leben von Jim Ripple erfährt er den symbolischen Tod bereits frühzeitig im Film. Mit der Präsentation seiner Roboter als Idee der Revolution, der Realisierung der Verfremdung Jims von der, im Film als proletarisch geltender, Ideologie und die letztliche Verstoßung aus der Familie wird das symbolische Netz von Jims Sozialisation und seinem ehemals soziokulturellen Umfeld vernichtet. Er tritt seinen Gläubigern im Verlauf des Filmes erneut gegenüber, trifft seinen Bruder, seine Schwester und tritt in Gestalt der R.U.R. vor die Arbeitergemeinde. Eine Läuterung seines Tods bleibt in allen diesen Szenen aus. Im Gegenteil verschlimmern sich in jeder dieser Szenen die vorher bestandenen Verhältnisse zueinander und machen den symbolischen Tod umso unabwendbarer bis Jim sich derart entfremdet hat, dass sein Bruder Jack sich im biblischen Sinne frei von Schuld fühlt, als den ersten Stein auf Jim wirft und einen Brudermord riskiert. Am Kopf getroffen soll Jim aber nicht so den physischen Tod finden. Die Antwort des Militärs auf den Steinwurf ist es, die R.U.R. zu mobilisieren und zum Krieg gegen die Arbeiter*innen zu lenken. So geschieht es, dass Jim bei dem Versuch stirbt, seine Roboter mit eigener Kraft aufzuhalten, diese ihn aber, ohne auf seine Signale zu reagieren, einfach unter den großen Metallfüßen zerquetschen.
Der Erschaffer der Kreaturen kann sie letztlich nicht aufhalten. Wer sie aber aufhalten kann, sind am Ende die organisierten Arbeiter*innen. Durch den, im Verlauf des Films in der geheimen Fabrik eingeschleusten Techniker Roy aus dem Umfeld der Arbeiterklasse, konnte diese die Steuerungsapparatur der R.U.R. in besserer Form kopieren und die R.U.R. so als Waffe gegen die Angreifer verwenden.
3. Zusammenfassung
Autoren wie Althusser, aber auch Gramsci, haben sich in Bezug auf den Marxismus eine Frage gestellt. Und zwar, wieso der Marxismus keine organisierte Arbeiterklasse hervorbringen konnte, die die Krisen des Kapitalismus nutzt, um in der Form des Kommunismus eine Änderung der sozioökonomischen Verhältnisse zu erwirken. Zu Beginn des Films erscheint die Arbeiterklasse ähnlich lethargisch wie in der formulierten Hinterfragung des Marxismus. Tatsächlich wird uns Jim als ein marxistischer Denker vorgestellt, der Missstände erkennt und Ambitionen vertritt, die die Arbeiter*innen in gewissen Gesichtspunkten entlasten könnten. Durch seine Gratwanderung verliert seine Idee allerdings an marxistischer Wirkungsmacht, ist Jim, postmarxistisch betrachtet, doch zu sehr fokussiert auf eine synergetische Revolution im Rahmen der ökonomischen Möglichkeiten und reflektiert demnach zu stark sein Umfeld des repressiven und ideologischen Staatsapparates. Insgesamt erscheint Jim als ein Obduktionsobjekt der poststrukturalistischen, lacanschen Psychoanalyse. So erweist er sich als ein ambiger Charakter, der die Zweideutigkeit seiner Gratwanderung zwischen Proletariat und Bourgeoisie komplett internalisiert zu haben scheint, beide Pole der Dichotomie sich dann aber in bestimmten Bahnen festgefahren haben. So erscheint Jim Ripple am Ende als ein Antiheld, der irgendwo das Richtige mit den falschen Mitteln verändern wollte. Jedoch brachte er am Ende das Proletariat gerade dadurch dazu, sich zu organisieren und letztlich gegen die Obrigkeit aktiv zu werden, und wenn nur aus einer Defensive gegen den repressiven Staatsapparat und nicht gegen das kapitalistische System im Ganzen. Bis zu diesem Punkt nimmt uns der Film auf jeden Fall letztlich mit. Was danach geschieht, erfahren wir nicht. Wenn das krisenbehaftete Land ohne Namen am Ende die Krise überwunden hat, unabhängig davon, in welchem Wirtschaftssystem sich das Land dann befindet, so kann man doch behaupten, dass Jim Ripple als unfreiwilliger Initiator der proletarischen Organisation zwei marxistische Märtyrertode gestorben ist.
5. Literatur
Althusser, Louis (1977): Ideologie und ideologische Staatsapparate: Aufsätze zur marxistischen Theorie. Hamburg: B-Books-Ausgabe.
Žižek, Slavoj (1991): Liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques Lacans Psychoanalyse und die Medien. Berlin: Merve Verlag.
Žižek, Slavoj (1992): Mehr-Genießen. Lacan in der Populärkultur. Wien: Turia + Kant.
Žižek, Slavoj (1998): Das Unbehagen im Subjekt. Wien: Passagen.
Žižek, Slavoj (2008): Lacan. Eine Einführung. Frankfurt am Main: Fischer.
Anmerkungen
1 Eine unmittelbare Anlehnung an das gleichnamige Drama des tschechischen Schriftstellers Karel Čapek, in dem das Akronym widerum für “Rossum’s Universal Robots” steht.
2 Gerade die poststukturalistischen Analyseansätze von populärkulturelle Medien von Žižek seien hier als Vorbild für die essayistische Auseinandersetzung genannt.
3Althusser: 1977
4 Žižek: 2008
5 Es kann ebenso auf Bereiche wie die Befriedigung von Eigentum oder Recht wirken.
6 Referenzierend zu Žižeks Buchtitel: „Liebe Dein Symptom wie Dich selbst!“
7 Žižek (1998): 153
8 Žižek: 1991